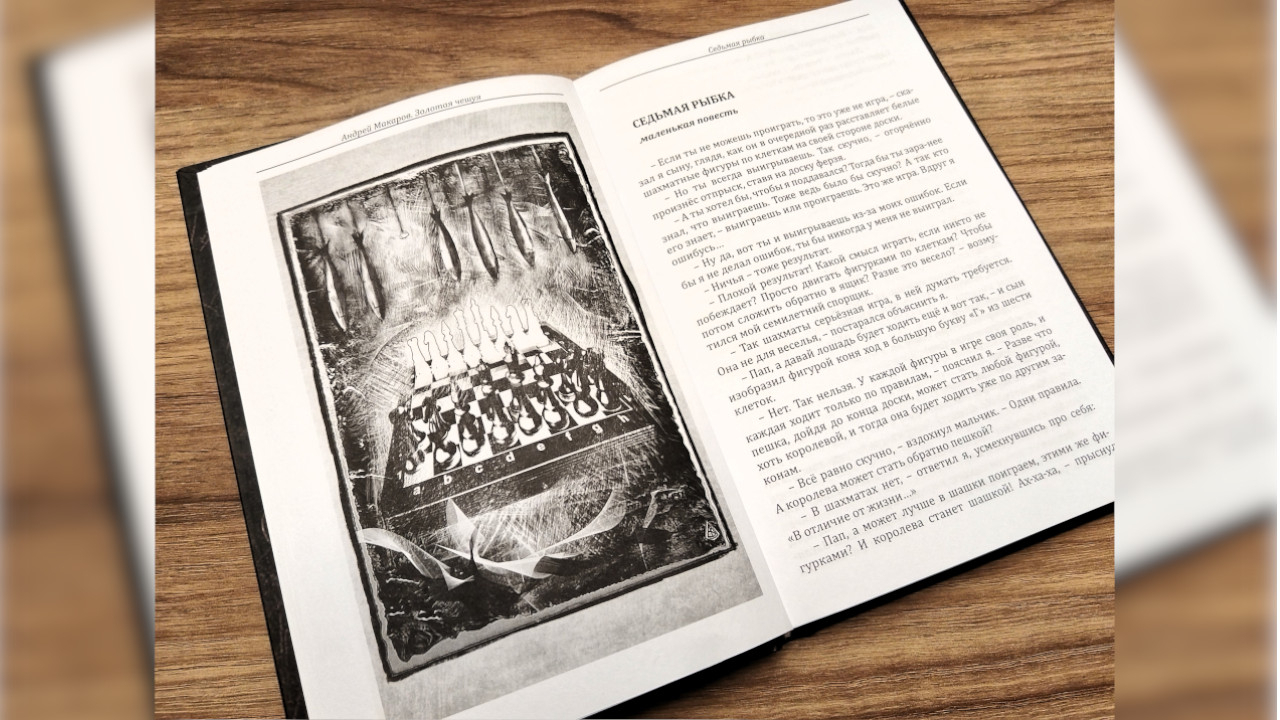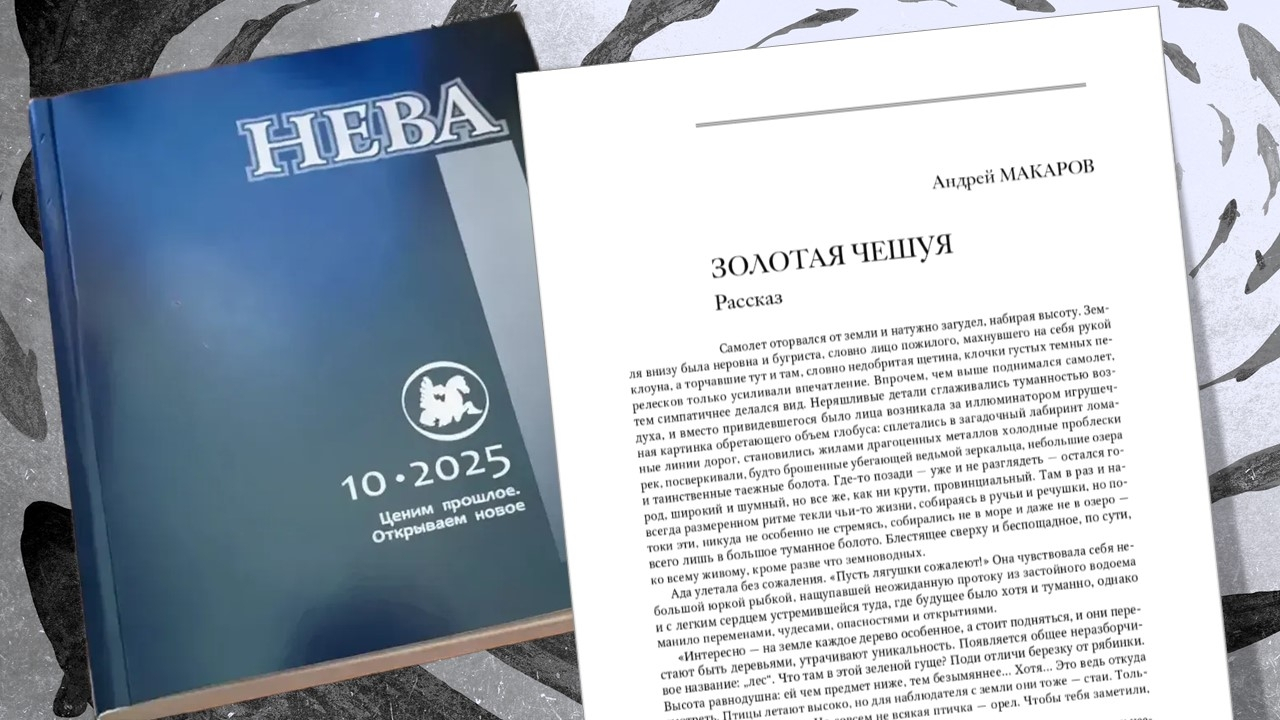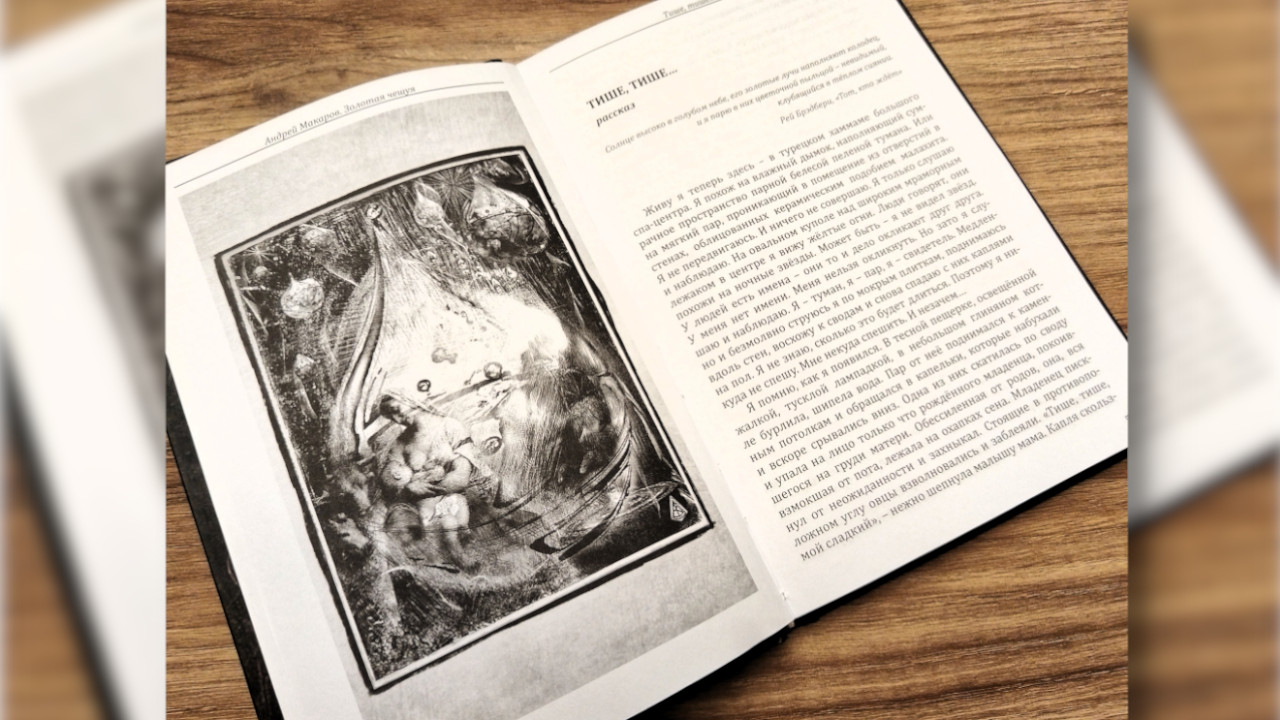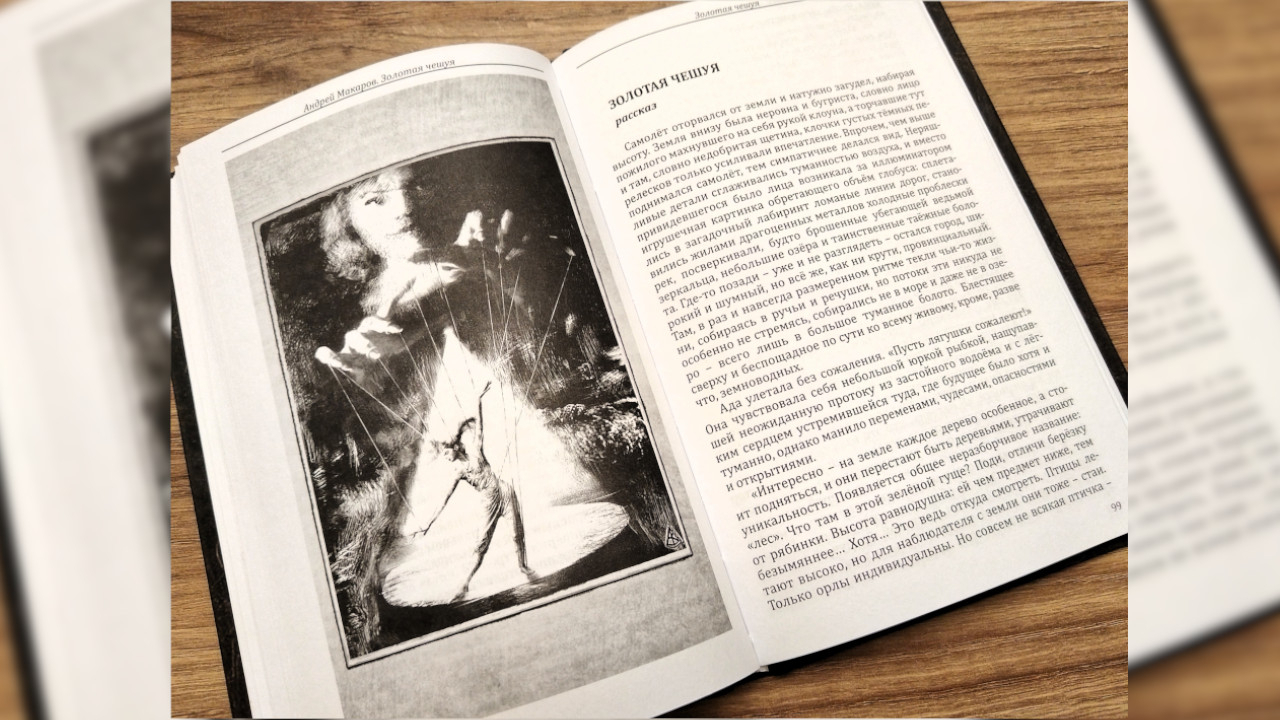Das zweite Buch des Schriftstellers und Unternehmers Andrei Makarow (deutscher Name Ortlieb) ist erschienen. Sein Kurzgeschichtenband „Goldene Schuppen“ (russ. „Solotaja tscheschuja“) war einer der fünf Gewinner des Förderwettbewerbs 2025 des Kulturministeriums der Republik Komi für die Veröffentlichung und Verbreitung gesellschaftlich relevanter Literatur in der Kategorie „Belletristik für Erwachsene“. Wir sprachen mit dem Autor über den Inhalt des Buches und seine Intention.
Andrei, für diejenigen, die dein Buch noch nicht gelesen haben: Worum geht es darin?
Ilja Kormiltsew sagt: „Fische im Aquarium erkennen, dass die Welt nicht hinter der Scheibe endet. Dort, jenseits des Glases, liegt ihr Paradies. Sie träumen davon und glauben, nach dem Tod dorthin zu gelangen“.
Genau darum geht es in meinem Buch. Es geht um Menschen, die in selbstgebauten Aquarien leben und die Scheiben nicht bemerken. Es geht um goldene Schuppen – die Masken von Erfolg, Status und dem „richtigen Leben“. Es geht um den Moment, in dem ein Mensch gegen eine unsichtbare „Scheibe“ stößt und erkennt, dass alles, was er aufgebaut hat, ein Käfig ist.
Jeder sucht nach einem Ausweg. Manche finden ihn im Tod. Manche in der Flucht. Manche in der Akzeptanz. Und manche erkennen, dass der Ausweg immer da war – sie mussten sich nur entscheiden. „Goldene Schuppen“ stellt die Frage: Ist es möglich, sich zu befreien, ohne die Scheibe über dem Kopf zu zerbrechen?
Was wolltest du als Autor dem Leser vermitteln? Für wen ist die Kurzgeschichtensammlung „Goldene Schuppen“ geschrieben?
Dieses Buch ist für all jene, die das Gefühl haben, nicht ihr eigenes Leben zu leben, die sich Fragen stellen wie: „Wer bin ich?“, „Warum bin ich hier?“, „Was ist der Sinn meines Lebens?“ Für all jene, die sich intuitiv wie in einem Goldfischglas fühlen und keinen Ausweg finden.
Das Buch liefert keine Antworten, es schließt keine Fragen – es wirft sie auf. Es sind Fragen, auf die es keine richtigen Antworten gibt. Aber es gibt einen Weg, mit ihnen zu leben – ohne davonzulaufen, ohne sich zu verstellen, ohne sich mit Arbeit, Alkohol oder den Zielen anderer zu betäuben. Das Buch spricht mit dem Leser über das, was wirklich zählt. Und es ist ein sehr intimes Gespräch, in dem der Leser beginnt, sich selbst zu hören – so wie er ist. Ohne „Ich sollte so sein“. Ohne Maske. Ohne Schuppen.
Das war wohl auch das Hauptziel meiner Geschichtenreihe: dem Leser zu zeigen, wie man authentisch und lebendig sein kann, ohne sich dafür zu schämen.
Das Bild eines Fisches, eines Aquariums – wie ist es bei dir im Sinne aufgetaucht?
Bilder entstehen nicht einfach so. Sie tauchen auf, wenn man bereit ist, sie zu sehen.
Ich saß einmal in einem Restaurant, dessen Boden mit Goldfisch-Aquarien ausgestattet war. Wunderschön, teuer. Und plötzlich sah ich es mit anderen Augen. Die Gäste an den Tischen waren wie Fische. Jeder in seinem eigenen Aquarium. Sie stießen mit den Gläsern an, lächelten, unterhielten sich über Geschäfte und Urlaube … Sie lebten in Grenzen, die sie nicht sahen. Ich dachte: Ich auch. Ich schwimme in meinem eigenen Aquarium. Ich sehe die Scheiben nicht. Ich glaube, es ist die ganze Welt. Und jemand schaut hinunter und ist berührt. So entstand die Idee zu der Geschichte „Goldfisch“ aus der Reihe, die ich als erste schrieb. Und dann entstand die gesamte Sammlung – sieben miteinander verbundene Texte, vereint durch eine wiederkehrende Metapher: Der moderne Mensch ist ein Fisch im Aquarium, der das Glas mit den Grenzen der Welt verwechselt.
Und der Titel der ganzen Sammlung? Wie kam er zustande, und hat er sich im Laufe der Zeit verändert?
Der Titel kam zuletzt. Ich schrieb Kurzgeschichten, und in allen tauchen Fische auf. Aquarien, Schuppen, Flossen. Als ich die Texte zusammenfügte, wurde mir klar, dass es um Menschen geht, die äußerlich in Gold gehüllt sind, innerlich aber ersticken.
„Goldene Schuppen“ sind das, was wir tragen. Und genau das müssen wir erkennen und vielleicht sogar ablegen, um wirklich leben zu können.
Du hast also erkannt, dass wir modernen Menschen wie in einem Goldfischglas sitzen, jeder für sich, und hast dein eigenes Leben überdacht. Bedeutet das, dass dein Buch im Grunde ein Versuch ist, der Gesellschaft zu helfen?
Der Gesellschaft helfen? Nein. Ich bin kein Altruist. Und auch kein Idealist. Ich glaube nicht, dass sich die Gesellschaft als Ganzes schnell verändern kann – an den Menschen hat sich über Jahrtausende kaum etwas geändert. Die Menschen sind immer noch dieselben.
Wir leben in einer Zeit, in der man alles haben und am Ende mit nichts dastehen kann. Wo Erfolg in Zahlen gemessen wird, Glück aber nicht. Wo Menschen ihr Leben nach einem Plan gestalten und sich dann im Spiegel nicht wiedererkennen.
Ich habe angefangen zu schreiben, um in erster Linie mich selbst und die Fragen, die ich mir stellte, zu verstehen.
Meine Geschichten sind ein Zeugnis. So läuft es. So sieht es von innen aus. Das sind die Fragen, die wir uns nicht trauen, laut auszusprechen. Und ob das irgendjemandem helfen wird oder nicht, liegt nicht in meiner Hand.
Die in der Sammlung enthaltenen Geschichten entstanden zu unterschiedlichen Zeiten, haben aber ein gemeinsames Thema. Hattest du von Anfang an die Absicht, sie als Buch zu veröffentlichen, oder entwickelte sich die Idee erst im Laufe des Schreibprozesses?
Das Ziel war von Beginn an klar: eine Reihe von Geschichten zu schreiben, die durch ein gemeinsames Thema verbunden sind und in einer Sammlung zusammengefasst werden sollten. Ich freue mich, dass mir dies gelungen ist und die Reihe zu einem in sich geschlossenen Werk geworden ist. Schon vor ihrer Veröffentlichung im Buch erschienen alle Texte in führenden Literaturzeitschriften wie „Newa“, „Sibirskie Ogni“, „Sever“ und „Periscop“. Drei der Geschichten wurden von Alejandro Ariel González, einem renommierten Übersetzer und Experten für russische Literatur sowie einer Schlüsselfigur der spanischsprachigen Russistik, ins Spanische übersetzt und 2025 in der spanischsprachigen Zeitschrift „Sever“ und „Periscop“. Drei der Geschichten wurden von Alejandro Ariel González, einem renommierten Übersetzer und Experten für „Eslavia“ (erscheint zweimal jährlich in Buenos Aires, Argentinien, Anm. d. R.) veröffentlicht.
Zwischen der Veröffentlichung Ihres ersten Romans „Der Weg zum weißen Ufer“ (russ. „Doroga k belomu beregu“) und der Kurzgeschichtensammlung „Goldene Schuppen“ vergingen fünf Jahre. Warum gab es so eine lange Pause? Gab es ab und zu Schreibblockaden?
Kurzgeschichten erfordern eine höhere Textdichte als Romane. Eine Geschichte zu schreiben ist mitunter viel schwieriger als einen Roman, obwohl sie um ein Vielfaches weniger Buchstaben umfasst. Die Idee in einer Kurzgeschichte oder Novelle muss konzentrierter, die Metapher ausdrucksstärker und feiner sein und auf allen Ebenen des Textes wirken. Dementsprechend sind die Anforderungen an Kurzgeschichten um ein Vielfaches höher als an längere Erzählungen. In der Weite der Geschichte gibt es keinen Raum für Nachlässigkeit. Der Leser bemerkt oder spürt sofort ein Scheitern. Ich bin nie bereit, einen unfertigen Text zu veröffentlichen, weder aus literarischer Sicht noch aus meiner Perspektive als Autor. Hier gilt, wie man so schön sagt, die heilige Regel: Weniger ist mehr. Und das braucht Zeit.
Da alle meine Texte die strenge Auswahlprüfung der Literaturzeitschriften bestanden haben, glaube ich, dass ich meine Aufgabe erfüllt habe. Und die Tatsache, dass die Sammlung „Goldene Schuppen“ zu den Gewinnern des Förderwettbewerbs des Kulturministeriums der Republik Komi gehörte, bestätigte nur die Qualität und Relevanz des Buches.
Und hattest du also Schreibblockaden in diesen fünf Jahren? Falls ja, wie hast du diese überwunden?
Das kommt darauf an, was man unter einer Blockade versteht. Wenn es bedeutet, monatelang nicht zu schreiben, dann ja, das ist mir schon passiert. Mehr als einmal. Aber ich sehe es nicht als Problem. Eher als eine Pause. Eine Zeit, in der sich etwas in mir ansammelt, reift und nach Form sucht.
Ich gehöre nicht zu denen, die jeden Tag nach Plan schreiben. Keine innere Ordnung – kein Text. Sich an den Tisch zu setzen und Wörter herauszupressen, führt zu lebloser Prosa. Das kann ich nicht. Und ich will es auch gar nicht können. Wenn ich still bin, beobachte ich. Ich höre zu. Ich erinnere mich. Ich schreibe etwas auf. Und dann wache ich eines Tages auf – und der Text ist schon da. Vollständig. Man muss ihn nur noch aufschreiben.
Man muss sich nicht zwingen. Man braucht Geduld. Vertrauen in den Prozess. Und verstehen, dass auch eine Pause Teil des Schaffens ist.
Hast du irgendwelche Rituale, um in kreative Stimmung zu kommen? Fällt es dir überhaupt leicht, dich komplett von der Handlung zu lösen und ein einfaches Leben zu führen, oder kreisen die Gedanken ständig um die Geschichte, nähren unaufhörlich die Fortsetzung und feilen gedanklich an den Zeilen? Zu welcher Tageszeit schreibst du normalerweise?
Rituale sind für diejenigen, die sich erst dazu überwinden müssen. Ich brauche sie nicht. Wenn der Text reif ist, verlangt er nach seiner Veröffentlichung. Wie eine Geburt. Er fragt nicht, ob es passt, ob man Zeit hat, ob die Umgebung stimmt. Er ist einfach da. Und man setzt sich hin und schreibt.
Und davor, ja, das tue ich. Manchmal monatelang. Ich trage die Geschichte in mir. Die Figuren leben in mir, reden, streiten. Oft höre ich sie in den unpassendsten Momenten – in einer Geschäftsbesprechung, beim Abendessen, um vier Uhr morgens.
Dann kommt der Moment, in dem sich alles zusammenfügt. Und dann folgt mehrere Tage intensive Arbeit. Meistens nachts. Die Kinder schlafen, das Haus ist still, das Telefon stumm. Ein paar Stunden ungestörte Zeit, fernab vom Trubel.
Lässt man sich leicht ablenken? Nein. Solange die Geschichte nicht geschrieben ist, ist sie bei mir. Wie ein Splitter. Wie ein unvollendetes Gespräch. Sie lässt mich erst los, wenn ich sie beende.
Gibt es eine Geschichte im Buch, auf die du besonders stolz bist?
„Leise, ganz leise…“ (russ. „Tische, tische“) wird aus der Perspektive des Wasserdampfs erzählt, der die Menschen seit zweitausend Jahren beobachtet und am Ende fragt: „Warum bin ich hier?“ Das ist meine Frage. Und Ihre auch.
Diese Kurzgeschichte eröffnet die Reihe und prägt die Wahrnehmung des Lesers. Sie ist eine Hommage an Ray Bradbury und zugleich eine Auseinandersetzung mit ihm. In Bradburys „Der Wartende“ ist das Wesen im Brunnen ein Raubtier. Es wartet darauf, dass Menschen von ihren Körpern Besitz ergreifen. Mein Dampf ist kein Raubtier. Er will nichts. Er ist einfach da. Er beobachtet. Zweitausend Jahre. Und das ist viel erschreckender. Denn ein Raubtier ist verständlich.
Doch Existenz ohne Sinn, ohne Handlung, ohne Bedeutung – das ist wahrer Horror. Still. Unmerklich.
Die Geschichte beginnt mit der Geburt Christi. Ein Wassertropfen fällt auf das Gesicht des Babys. Die Mutter flüstert: „Leise, ganz leise, mein Schatz“. Und es entsteht Dampf. Die Geschichte endet mit demselben Flüstern. Der Kreis schließt sich. Zweitausend Jahre – und nichts hat sich verändert. Nur die Frage bleibt: „Warum bin ich hier?“
Die Geschichten im Buch werden harmonisch durch Radierungen des renommierten russischen Bildhauers, Malers und Grafikers Alexander Kostin ergänzt. Warum hast du dich entschieden, mit ihm zusammenzuarbeiten?
Ich kannte Alexander Kostin bereits vor der Arbeit an der „Goldenen Schuppen“. Er ist ein wunderbarer Künstler. Ich hatte das Gefühl, dass die Illustrationen in der Radiertechnik am besten zu meinen Geschichten passen – da sie ermöglicht Tiefe, sowohl visuell als auch inhaltlich. Das ist wichtig.
Es hat sich einfach so ergeben, dass Alexander einige meiner Geschichten gelesen hatte und sie ihn zu eigenen Werken inspirierten. In diesem Sinne handelt es sich nicht um Illustrationen im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr um eigenständige Werke. Daher hatte der Künstler völlige künstlerische Freiheit. Ich finde, die Werke sind gut gelungen, und ihre Präsenz im Buch bereichert das Leseerlebnis.
Dank der Unterstützung des Kulturministeriums und des Ministeriums für digitale Entwicklung der Republik Komi sind deine beiden Bücher nun in den meisten regionalen Bibliotheken erhältlich. Wie fühlt es sich an, die Bücher in den Bibliotheksregalen zu sehen?
Nicht nur regionale, sondern auch große nationale Bibliotheken. Sechzehn Exemplare einer offiziellen Auflage werden an die Russische Buchkammer geschickt, die einen Teil davon an führende russische und internationale Bibliotheken weiterleitet. So kann beispielsweise der Roman „Der Weg zum weißen Ufer“ in der Russischen Staatsbibliothek (Leninka-Bibliothek, Moskau), der Russischen Nationalbibliothek (Sankt Petersburg) sowie unter anderem in der Library of Congress in Washington, D.C., und den Bibliotheken der University of Pennsylvania und der University of Wisconsin ausgeliehen werden.
In den ersten Sekunden, wenn man sein Buch im Regal sieht, überkommt einen ein Gefühl der Freude. Es hat sich gelohnt. Es existiert. Jemand kann es in die Hand nehmen, aufschlagen und lesen.
Manchmal schreiben mir Leser. Sie sagen, mein Buch habe sie berührt. Dass sie sich darin wiedererkannt haben. Und dann ist da dieses Gefühl, das das Schreiben wirklich lohnenswert macht. Nicht Stolz. Eher eine Verbindung. Das Buch wurde zu einer Brücke. Ich habe es geschrieben, jemand hat es gelesen und erkannt, dass er nicht allein ist.
Arbeitest du momentan an etwas Neuem?
Ja, ich habe ein paar Geschichten in Arbeit. Ich feile sozusagen noch daran, damit sie richtig gut werden. Und ich habe eine Idee für ein größeres Werk, das auf einem Mythos basiert.
Der Roman „Der Weg zum weißen Ufer“ ist eine Rückschau auf die Kindheit, auf die eigenen Wurzeln, auf die Erkenntnis der eigenen Identität und Herkunft. Die Kurzgeschichtensammlung „Goldene Schuppen“ erzählt davon, wer man nicht sein sollte und wie man sich von Illusionen befreit.
Doch Gott hat dem Menschen nicht nur Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch die Zukunft gegeben. Und ich möchte zeigen, wie diese Zukunft in meiner Weltanschauung aussehen könnte – die Zukunft der Menschheit und der von ihr geschaffenen Zivilisation. Und der Mythos, als ein für unser Leben grundlegendes Phänomen, wird dabei, so glaube ich, äußerst hilfreich sein. So eine herausfordernde und zugleich faszinierende Aufgabe.
Worüber könnten deine Leser deiner Meinung nach sonst noch gerne lesen?
Ich bin überzeugt, dass jeder Text, der im Leser ernsthafte und bedeutsame Fragen über sich selbst und die Welt aufwirft, die Grundlage für seine zukünftige Entwicklung bildet.
Alles kann einen spirituellen Wandel auslösen – von einer einfachen Detektivgeschichte bis hin zu den Werken anspruchsvollerer Autoren wie Albert Camus, Marcel Proust oder Thomas Wolfe. Die einzige Frage ist, welches Ziel der Leser verfolgt, wenn er ein Buch aufschlägt: Langeweile vertreiben, unterhalten werden oder endlich etwas sehen oder verstehen zu wollen, was ihm zuvor verborgen geblieben war. Ich selbst plädiere natürlich für eine neue Sichtweise und die Weiterentwicklung der Menschheit. Denn schließlich, so sagt die Heilige Schrift, wurde der Mensch nach Gottes Bild und Gleichnis geschaffen.